Berlin Biennale 5: Abundanter Diskurs im Vagen
07.04.2008Jenseits tradierter Ästhetik verläuft der Diskurs der jungen Kunst und Künstler. Die 5. Berlin Biennale 2008 zeigt Werke, die meist nicht abbildbar sind. Vielleicht weil visuell banal, allein peripher noch Kunst – und dies im visuellen Zeitalter.
Kein Zufall, die FAZ und die Berliner Zeitung greifen auf das gleiche Werk zurück: zeigen eine digital-schematisierte Faust. Das Werk von PIOTR UKLANSKI steht vor der Neuen Nationalgalerie, bildet einen hübschen Gegensatz von sozialistischer MachtGebärde zum ästhetisch-coolen Mies-van-der-Rohe-Gebäude, einer Ikone der Moderne, die frei historischer Gefühlslagen ist.
Kindergarten, Schrebergarten … so lauten erste Besucher-Urteile. Die Auseinandersetzung der jungen Künstler veranschaulicht eine Verweigerungs-Haltung zur bisherigen Kunst und Ästhetik, besonders zu Malerei. Kein Werk setzt fort oder erweitert kritisch den Diskurs von Farb-Form und Materie/Raum. Dennoch attackieren die in der Neuen Nationalgalerie präsentierten Werke die heroische Moderne und scheitern, unterlaufen leider die Vorgaben dieser kühn-modernen Architektur.
Viele Werke erschöpfen sich im puren Anti, agieren dilettantisch mit verunglückten Wellenformen, bunt-glitzerndem Swarovski Tand, Spiegelungen von Innen/Aussen, ein Gegensatz, der gerade Mies überwand. Der Altmeister van der Rohe triumphiert post mortem gegenüber den Youngster, deklassiert diese zu hilflosen Heulsusen im VaterKonflikt.
Im PostHeroismus verlaufen die Kunst-Attacken anders. Präzis sind die Erweiterungen des künstlerischen Arsenals bei Matthew Barney (Alltags-Mythen als erotische Obsession, samt Vaselin als neues Kunst-Material) oder Elafur Eliasson (nüchterner Mythos der Licht-Techniken) oder Maurizio Cattelan (Verunsicherungen wie bei Marcel Duchamp).
Leider bestätigte sich die Vorahnung: die kleingeistigen und kleinformtigen Werke scheitern am heroischen Gestus der abstrakten Moderne, am ingeniösen Raum von Mies van der Rohe … auch wenn läppisch-bunte Wimpel von DANIEL KNORRl die Strenge des Baus verulken, diesen nett dekorieren.
Künstler, nicht Werke sollten ausgestellt werden – so das Konzept der beiden KuratorInnen Elena Filipovic und Adam Szymczyk. Das Fehlen thematischer Vorgaben ‘rächt’ sich durch eine Abundanz an Peripherem und Beiläufigem – das nie abartig sich qualifiziert.
Der Titel “When Things cast no Shadows” bumerangt kontrafaktisch, diese Berlin Biennale wirkt keinen Schatten, nicht mal in nächste Zukunft.
Jeannot Simmen
Künstler
Kommentare
-
In Jean-Paul Sartres “Les jeux sont faits” begreifen die (gewaltsam) zu Tode Gekommenen ihren Tod dadurch, dass sie keinen Schatten werfen und mit ihrer Umwelt nicht mehr kommunizieren können. Das Band zwischen Geist und Materie ist durchtrennt, die Seele im Materiellen nicht mehr vorhanden.
Vielleicht, so fragte ich mich angesichts der gähnenden Leere, die ich in der Neuen Nationalgalerie empfand, könnte hier ein Schlüssel zu den ausgestellten Objekten sein ? Vielleicht haben wir es hier tatsächlich mit etwas Totem zu tun, mit etwas Seelenlosem, dem nur noch die materielle Hülle geblieben ist und mit uns nicht mehr kommuniziert ? Das keinen Schatten mehr werfen kann ?
Der russische Filmregisseur Andrej Tarkowskij spricht in seiner “Die versiegelte Zeit” betitelten Schriftsammlung davon, dass uns ein Kunstwerk auf unseren Tod vorbereiten soll – so zu verstehen, dass es uns wach rüttelt für die ausserhalb unserer materiellen Existenz befindlichen und unteilbar zu uns gehörenden Dimensionen. Insofern stellt sich beim Anblick der meisten der ausgestellten Objekte die Frage, ob sich nicht gerade in dieser Kommunikationslosigkeit, dieser Schattenlosigkeit und Leere auch eine Tragik widerspiegelt, dahin gehend, dass unser “Zeitgeist” zu einer leeren Hülle verkommen ist ?— Astrid Vehstedt · 24. April 2008, 09:36
Jeannot Simmen: WunschZettel: Berliner Kunsthalle Berlin Biennale 5: Rundgang Neue Nationalgalerie
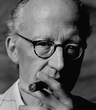
In Jean-Paul Sartres “Les jeux sont faits” begreifen die (gewaltsam) zu Tode Gekommenen ihren Tod dadurch, dass sie keinen Schatten werfen und mit ihrer Umwelt nicht mehr kommunizieren können. Das Band zwischen Geist und Materie ist durchtrennt, die Seele im Materiellen nicht mehr vorhanden.
Vielleicht, so fragte ich mich angesichts der gähnenden Leere, die ich in der Neuen Nationalgalerie empfand, könnte hier ein Schlüssel zu den ausgestellten Objekten sein ? Vielleicht haben wir es hier tatsächlich mit etwas Totem zu tun, mit etwas Seelenlosem, dem nur noch die materielle Hülle geblieben ist und mit uns nicht mehr kommuniziert ? Das keinen Schatten mehr werfen kann ?
Der russische Filmregisseur Andrej Tarkowskij spricht in seiner “Die versiegelte Zeit” betitelten Schriftsammlung davon, dass uns ein Kunstwerk auf unseren Tod vorbereiten soll – so zu verstehen, dass es uns wach rüttelt für die ausserhalb unserer materiellen Existenz befindlichen und unteilbar zu uns gehörenden Dimensionen. Insofern stellt sich beim Anblick der meisten der ausgestellten Objekte die Frage, ob sich nicht gerade in dieser Kommunikationslosigkeit, dieser Schattenlosigkeit und Leere auch eine Tragik widerspiegelt, dahin gehend, dass unser “Zeitgeist” zu einer leeren Hülle verkommen ist ?
— Astrid Vehstedt · 24. April 2008, 09:36